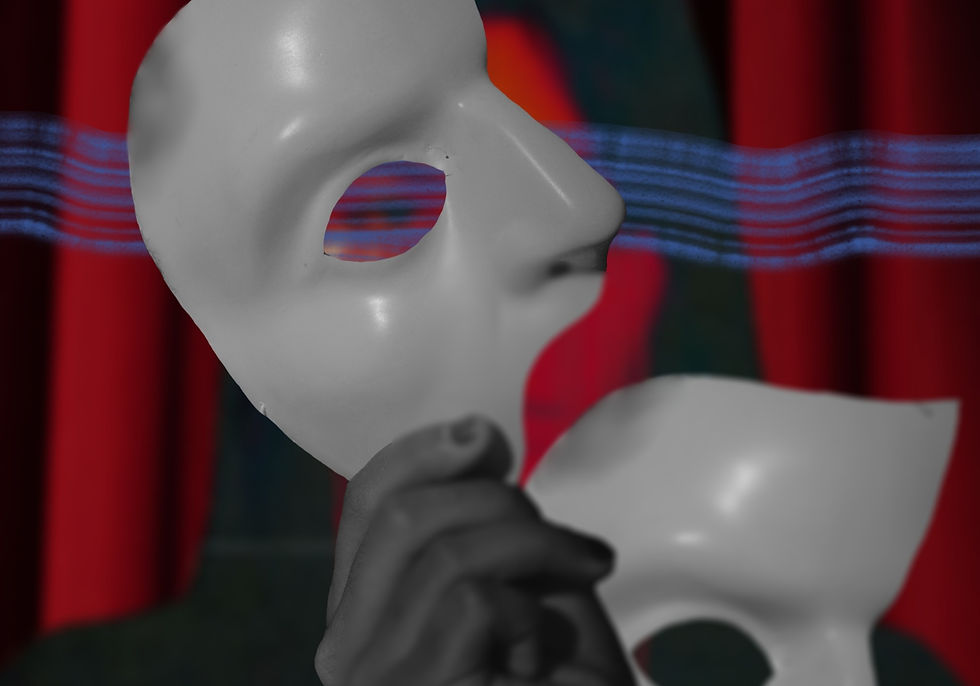Die Meerjungfrau. Eine Abrechnung
- Lisa Maria

- 9. Juli 2023
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 15. Apr. 2024

Meerjungfrauen sind oft die Heldinnen kleiner Mädchen* und als nostalgisches Kulturprodukt durch Filme wie Disneys Arielle ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Der Aufschrei, der 2019 auf die Besetzung der Arielle durch die schwarze Schauspielerin Halle Bailey folgte, verdeutlicht eine der strikten Erwartungshaltungen, die mit dem Motiv verknüpft ist. Doch es gibt noch zahlreiche weitere: Nicht nur hat eine Meerjungfrau weiß, sondern auch schlank, schön und eine ganze Reihe weiterer Dinge zu sein. Die gesamte Genese dieser Kunstfigur basiert auf jahrhundertealten sexistischen Voraussetzungen.
Weibliche Wasserwesen existieren seit mehreren Jahrhunderten bis Jahrtausenden in verschiedenen Formen in verschiedenen Geschichten und Kulturen. Im abendländischen Kontext findet man sie mitunter als Sirenen: Schon in der griechischen Mythologie von Homer beschrieben sind diese betörende weibliche Wesen, die Männer durch ihren Gesang verzaubern und diese damit in den Tod locken wollen. Ursprünglich als Vogelfrauen angelegt, also als weibliche, größtenteils menschliche Körper mit Flügeln und Klauen, die über Schiffen auf dem Meer kreisen, wurden sie in der bildenden Kunst später meist als Wasserwesen dargestellt, die in den Wellen auf ihre Opfer warten. Cleveren männlichen Protagonisten wie Orpheus oder Odysseus gelang es, ihrer List zu entgehen, indem sie den Gesang übertönten oder ihre Ohren und die ihrer Besatzung mit Wachs füllten. Odysseus wollte dennoch in den Genuss der verführerischen Stimmen kommen und ließ sich einfach am Schiffsmast festbinden. So konnte er beides haben: die auditive Stimulation der attraktiven, gefährlichen Sirenen erleben und trotzdem die Macht über seinen Körper und sein Leben erhalten und damit die Macht der Sirenen unterminieren. Der Mann hat gewonnen.
Weitere weibliche Wasserwesen neben den Sirenen sind Wassergeister. In der griechischen Mythologie sind sie Nymphen oder auch Najaden, in anderen Sagen, Märchen und Volksglauben werden sie auch Nixen oder Undinen genannt. Die mit den verschiedenen Wassergeistern verbundenen Vorstellungen sind sehr unterschiedlich und die Positiv- oder Negativkonnotation der Figuren hat sich im Laufe der Jahrhunderte mitunter stark verändert. Nymphen in der griechischen Mythologie sind (niedere) Gottheiten und als Naturgeister ursprünglich eher friedlich konnotiert. Die Auslegung der Nymphe als Naturpriesterin hat über das Mittelalter jedoch auch zur Verbindung des Motivs zur Hexerei und bösen Mächten geführt. Diese Verbindung wurde oftmals gezogen, wenn Frauen besondere Fähigkeiten oder Stärken besaßen. Eine ständige Übersexualisierung weiblicher Figuren allgemein – sehr deutlich zeigt sich dies z. B. in der Kunst – hat auch den Begriff der Nymphomanie hervorgebracht: Obwohl Nymphen mythologisch keinerlei direkten Zusammenhang zu sexuellem Übermaß aufweisen, ist die Nymphomanie als pathologische Sexsucht begrifflich an die Nymphe angelehnt. Und im Allgemeingemeinverständnis auch auf das übertriebene Begehren von Frauen ausgerichtet, nicht auf das von Männern.
Um Nixen und Undinen, deren Narrative sich nicht direkt aus der griechischen Mythologie, sondern aus weiteren Sagen und Märchen speisen, steht es nicht viel besser: Mal werden sie als bezaubernde Wesen mit schönen Singstimmen beschrieben, die erst durch die Liebe eines menschlichen Mannes eine Seele erhalten können und ihm bei Untreue den Tod bescheren, mal als ambivalente Weiber, die zwischen Genusssucht und Boshaftigkeit schwanken. Mal helfen sie den Seefahrern, mal entführen und ertränken sie Kinder. Mit Hans Christian Andersens Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ von 1837 ist schließlich das heute gängige Bild der Meerfrau geboren: Die schöne Tochter des Meereskönigs hat einen Fischschwanz statt Beine, doch ebenfalls keine Seele, verliebt sich in einen menschlichen Prinzen und opfert sich auf, um seine Liebe zu erlangen, jedoch erfolglos. Arme Arielle.
Weibliche Wasserwesen in Geschichten des europäischen Kulturkreises sind vielfältig und schwanken zwischen Erotisierung und Verteufelung, Unschuld und Schuld, femme fragile und femme fatale. Egal ob lieblich und schwach oder mächtig und böse – sie sind im Wesentlichen Männerfantasien. Dies lässt sich anhand von Meerfrauen-Darstellungen in der Kunst illustrieren. (Kleiner Exkurs zu Frauen in der bildenden Kunst: Frauen waren die längste Zeit der Kunstgeschichte massiv unterrepräsentiert auf Seiten der Kunstschaffenden, jedoch massiv überrepräsentiert als erotische, nackte Figuren auf Bildern. Ein male gaze ist vorprogrammiert.) Sowohl Sirenen als auch Wassergeister und Meerjungfrauen sind in der Regel unbekleidet dargestellt und entsprechen den zur jeweiligen Epoche geltenden Schönheitsidealen. Hauptsächlich sollen sie dem (männlichen) Betrachter gefallen und durch Fixierung im Bild als Frauen gezähmt werden.
Im späten 19. Jahrhundert, als u. a. im Symbolismus die Idee der femme fatale zutiefst in Mode war, werden auch ihre Darstellungen auf die Spitze getrieben. Ein Beispiel: Auf Ferdinand Max Bredts Gemälde „Die Sirenen“ haben die zwei gemalten Frauen noch Vogelfüße statt einen Fischschwanz und blicken provokativ und wollüstig den Betrachter an. Sie sind üppig und natürlich nackt, das Haar der einen reicht ihr bis weit über die Hüfte, sie krallt sich an einen Felsen, streckt das Kinn vor und hat leicht geöffnete Lippen. Sie schaut, als würde sie den Betrachter im nächsten Moment sexuell verschlingen und ihn zugleich zerstören wollen. Sie ist femme fatale in Vollendung. In anderen Szenerien werden die Frauen eher als verspielt und gleichgültig-zerstörerisch gezeichnet, wie in „Die Höhle der Sturmnymphen“ von Edward John Poynter. Drei Nymphen lassen ein Schiff im Sturme untergehen, räkeln sich mit Blick darauf in einer Höhle, werfen mit Geld umher, machen ein wenig Musik und wühlen in den schon erbeuteten Schätzen. Dass sie keine Kleidung tragen, ist selbstredend und muss ab hier wohl auch nicht mehr erwähnt werden. Doch auch ganz fragil anmutende Frauen, beinahe Mädchen sind zu dieser Zeit auf Gemälden zu finden. „Eine Meerjungfrau“ von John William Waterhouse sitzt unschuldig an einem steinigen Strand, neben sich eine Schale mit wenigen Schmuckstücken, und bürstet ihr prächtiges, langes Haar. An ihr könnte man nichts Bösartiges vermuten, sie scheint die personifizierte Unschuld zu sein und auf ihren Retter zu warten.
In all diesen – und den allermeisten anderen Fällen – wird mit Stereotypen von Weiblichkeit gearbeitet, die männliche Maler erregt und fasziniert haben. Doch auch Malerinnen haben an diesen Darstellungspraktiken partizipiert. Vermutlich mussten sie das auch, da ihr Zugang zur Kunstwelt ohnehin erheblich eingeschränkt war und Bildinhalte hauptsächlich männlichen Käufern, Kunsthändlern usw. zu gefallen hatten. „Die Sirenen“ von Henrietta Rae räkeln sich am sandigen Ufer, während diejenige im Bildmittelpunkt mit Spiegel in der Hand ihre eigene Schönheit dem Betrachter zur Schau stellt, sich lasziv präsentiert, gefällt. Lieblich und harmlos sehen sie aus, doch das Flötenspiel einer Sirene im Hintergrund hin zu einem vorbeisegelnden Schiff erinnert an ihre boshaften Machenschaften. Sie sind femmes fragiles – von fragiler Erscheinung, doch sie konspirieren im Untergrund.
Man möge einwenden, dass der Zerstörungswut der Sirenen eine gewisse Macht innewohnt, die emanzipatorisch gedeutet werden kann. Doch diese These verflüchtigt sich, wenn man sich vergegenwärtigt, ob dem eine reale Macht entspricht – das tut sie nämlich nicht. Davon, dass in dieser Motivik Frauen als sexy Unglücksbringerinnen dargestellt werden, haben Frauen nichts. Es handelt sich um erotisierende Fantasien über Frauen aus Geschichten, die größtenteils von Männern geschrieben wurden, und um dazugehörige bildliche Darstellungen, die größtenteils von Männern geschaffen wurden. Die Meerfrauen sind dabei Objekte, mit denen man sich auf bestimmte Weisen beschäftigen kann. Ganz klassisch mit Simone de Beauvoir gedeutet tritt der Mann so als transzendentes Subjekt auf, das geistig und schöpferisch arbeitet, und die Frau als immanentes, körperliches Wesen, das als Objekt betrachtet werden kann. Die weiblichen Wasserwesen sind als Alteritäten konzipiert, nur in Bezug auf männliche Figuren, auf die ihre Handlungen hinleiten: Sirenen stürzen die männlichen Seefahrer in den Tod, Meerjungfrauen warten auf die Erlösung und den Erhalt einer Seele durch den Geliebten. Ohne Männer haben diese Frauen nichts zu tun. Der Mann wird als menschliches Normalwesen gesetzt, während die Meerfrauen etwas Abnormes zu ihm und motivisch auf ihn ausgerichtet sind.
Denken wir zurück an Disneys Arielle: Es finden sich sicher viele Gründe, weshalb man das Motiv Meerjungfrau vielleicht einfach ad acta legen oder es zumindest in aller Deutlichkeit überarbeiten sollte. Hält man aus (Kindheits-)Nostalgie an all seinen Facetten fest, bleibt man auch bei seinen Sexismen. Proklamiert man die Notwendigkeit, dass Arielle weiß sein muss, fügt man noch Rassismen hinzu. Dass vor 150 Jahren alle Meerjungfrauen auf Gemälden nackt und weiß waren, ist leider ein Charakteristikum dieser (und sehr langer vorangehender und darauffolgender) Zeit(en). Doch im 21. Jahrhundert hat nichts mehr dagegenzusprechen, eine Rolle, die geographisch nicht zwingend an bestimmte Erdregionen gebunden ist, sondern schlicht an: das Meer!, schwarz zu besetzen. (And even if – ich erinnere ans 21. Jahrhundert). Bei allem oben Dargelegten geht es nämlich nicht nur um beliebige (pop-)kulturelle Motive, sondern auch allgemein darum, wie wir auf Frauen und Menschen überhaupt blicken. Sich dabei einige Schritte weiter von Stereotypen zu entfernen, halte ich für wünschenswert.
Titelbild: veränderter Ausschnitt aus Henrietta Rae: „Die Sirenen“, 1903