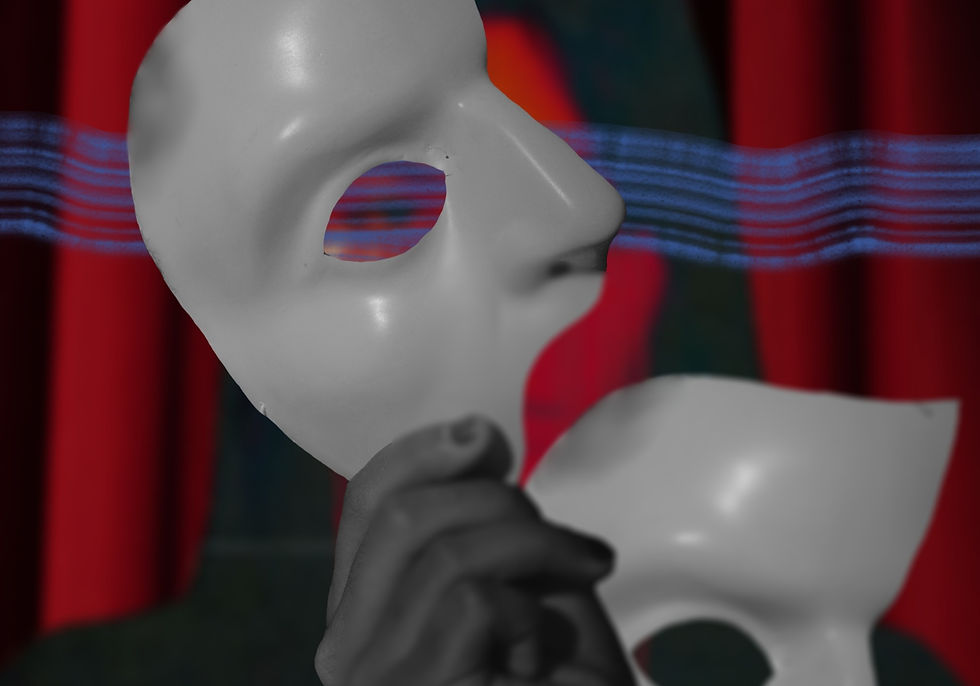Chihiros Reise ins Zauberland: Eine Dystopie weiblicher Arbeit
- Lisa Maria

- 9. Juli 2023
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 24. Sept. 2024

Shojo: Japanische Manga- und Anime-Darstellungen heranwachsender Mädchen, meist verträumt, süß und ultrafeminin. Chihiro ist eine heranwachsende Protagonistin im Anime, doch sie ist keineswegs shojo – weder präsentiert sie sich feminin noch legt sie eine liebenswürdige, niedliche Verträumtheit an den Tag. Der Zuschauer verfolgt die Geschichte einer Heranwachsenden, die ihr Selbstbewusstsein und Potential durch die Härte der Arbeit in einem ultrakapitalistischen und diktatorisch geführten Mikrokosmos entfaltet.
Der Regisseur Miyazaki Hayao ist bekannt dafür, starke Frauenfiguren als Heldinnen zu entwerfen und eine ausgeprägte Ethik und Gesellschaftskritik über Filminhalte zu vermitteln – seine Werke sind also nicht nur als Unterhaltungs- oder Kinderfilme zu sehen. Identitätsfindung, moralische und kulturelle Werte, Umweltverschmutzung, Industrialismus sowie Kapitalismus tauchen in seinen Geschichten immer wieder auf. So auch in Chihiros Reise ins Zauberland: Die zehnjährige Chihiro strandet durch das Verschulden ihrer Eltern, die sich unerlaubt an einem Buffet für die schintoistischen Gottheiten gütlich taten, in der Zauberwelt. Ihre einzige Chance, überhaupt dort zu überleben und sich und ihre in Schweine verwandelten Eltern retten zu können, ist die (Zwangs-)Arbeit in Yubabas Badehaus (japanisch: Yuya), das der Verwöhnung der Götter dient. Mit dieser – für eine Zehnjährige zweifelsohne hoch gesteckten – Herausforderung beginnt eine rasche persönliche Entwicklung für Chihiro. Sie ist mit einem Arbeitsplatz konfrontiert, der stark hierarchisch strukturiert ist, ihr körperliche Mühen abverlangt, in dem es keine privaten Rückzugsräume oder Raum für exklusive persönliche Habseligkeiten gibt, dessen Lohn-, Arbeitszeit- und Freizeitregelungen unklar bleiben und bei dem ständig die existenzielle Misere droht, sollte man versagen. Das Badehaus ist äußerlich ein traditionelles japanisches Gebäude, doch lässt ein hoher, schwarzen Rauch ausstoßender Schornstein auf den industriellen Unterbau der Einrichtung schließen. Sogar die hier gezeichnete Götterwelt ist so von Kapitalismus und Moderne durchdrungen, dass gar die Gottheiten Wellness zur Regeneration benötigen oder auch – im Fall eines alten Flussgottes – vom schlimmsten Schmutz und Unrat der Industriegesellschaft befreit werden müssen.
Die Kapitalismus- und Industriekritik sticht klar hervor. Besonders interessant ist jedoch, wie die Arbeitsverhältnisse strukturiert sind, deren Schlüsselpositionen von weiblichen Figuren besetzt werden: Repräsentativ sind
Chihiro als neue Arbeiterin auf der untersten Stufe der Hierarchie, die in ihrer Notlage ausgebeutet wird,
Lin, die eine fleißige und angesehene Arbeiterin im Badehaus ist und sich Chihiros annimmt sowie
Yubaba, die das Badehaus diktatorisch leitet und ihre Zauberkraft nutzt, um widerständige oder unproduktive Arbeiter und Eindringlinge in Tiere oder Gebrauchsgegenstände zu verwandeln (bzw. damit droht, dies zu tun).
Die weiblichen Figuren sind nicht die einzigen, die eine strenge Hierarchisierung des Badehauses deutlich machen. Ebenso ausgebeutet wie Chihiro wird der junge Haku, der sich gebunden durch einen Zauber Yubaba verpflichtet hat und entgegen seiner moralischen Werte arbeiten muss. Doch dass es sich im gesamten Betrieb um ein ausbeuterisches Arbeitsverhältnis ohne Alternativen handelt, wird auch in der Masse der männlichen sowie weiblichen Arbeitenden klar, die Lin repräsentiert. Sie alle leben und wohnen auch an ihrem Arbeitsplatz, sind von Luxusgütern abgeschnitten und finanziell dürftig versorgt – schon eine kleine Delikatesse wie ein gerösteter Salamander oder Trinkgelder, die auf weitere Großzügigkeiten hoffen lassen, bringen die ArbeiterInnen vollkommen in Aufruhr. Nahezu gänzlich abgeschnitten vom restlichen Betrieb lebt und arbeitet der alte Kamaji an den Kohleöfen. Sein Platz in der Hierarchie wird schon in der vertikalen Struktur der Räume deutlich: Yubaba ganz oben, er ganz unten in den Kellern. Mit sechs unermüdlich werkenden Armen ist er die ideale menschliche Arbeitsmaschine und treibt die kapitalistisch-industriellen Bestrebungen zur Produktivitätssteigerung ins Absurde. Was Chihiro, Lin und Yubaba jedoch jeweils zu Schlüsselfiguren der dargestellten Arbeitswelt macht, ist im ersten Fall die Protagonistinnenperspektive, die die bestehenden Strukturen zu durchbrechen versucht, im zweiten die Stellvertreterposition Lins für ihren gesamten Stand sowie im dritten das Ineinanderfallen der Unternehmensspitze und des „Bösewichts“ in eine (weibliche) Figur.
Alle drei Ausgangslagen scheinen wenig Mut machend. Was bedeutet es im angeführten Kontext, diese Rollen weiblich zu besetzen? Abgesehen davon, dass verschiedene Figuren im Film Eigenschaften tragen, die nicht klar in binäre Raster fallen, verdeutlichen die Frauen in Chihiros Reise ins Zauberland doch bestimmte Formen von Arbeit, die weiblich konnotiert sind, sowie bestimmte Stereotype und Problematiken, die damit einhergehen. Sehr eindeutig ist dies jedoch keine unreflektierte Reproduktion von Klischees durch Miyazaki, sondern eher eine Kritik am Postfeminismus, der feministische Anliegen voreilig als gelöst ansieht. Was das konkret heißt, lässt sich an den spezifischen Eigenschaften, Problemen und Herausforderungen der drei zentralen weiblichen Charaktere deutlich machen.
Yubaba
Sie ist die Leiterin des Badehauses und bewohnt dessen luxuriöse obere Etagen. Ihr Reichtum wird durch große Räumlichkeiten, üppige Innenausstattung und offensichtliche Wertgegenstände deutlich gemacht, mehrmals sieht der Zuschauer sie mit Beuteln voll Goldstücken auf ihrem Schreibtisch hantieren. Sie verhält sich herrisch, streng, gnadenlos, bedrohlich. Auffällig ist, dass sie nicht nur die einzige ist, die im Yuya keine Arbeitskleidung trägt, sondern dass sie als einzige westliche Kleidung und ein zu Teilen westliches Mobiliar besitzt – ein Marker für die kapitalistischen Güter und Werte, die auch den japanischen Markt geflutet und die japanische Gesellschaft ergriffen haben. Kritisch zu betrachten ist ein möglicherweise antisemitisches Motiv in ihrer Figur: Sie ist eine reiche Unternehmerin, deren Umgang mit größeren Geldmengen eindeutig hervorgehoben wird. Sie hat eine überproportional große, lange Nase. Diese wird zusätzlich betont, wenn sie sich in Vogelgestalt wandelt, in der ihr Gesicht zur Hälfte bedeckt ist und unter den Augen allein die Nase markant über ihre Ummantelung hervorsteht. Diese Gestalt nimmt Yubaba an, wenn sie das Badehaus unauffällig fliegend verlässt, um Dinge zu unternehmen, über die niemand Bescheid weiß und die im Filmkontext auch nicht aufgeklärt werden. Zwielichtige Geschäfte? Die Parallele zum antisemitischen Stereotyp des jüdischen Unternehmers und die relative Unklarheit, wie er zu seinem Reichtum kam, ist zu auffällig, um übersehen zu werden.
Sieht man von dieser Problematik der Darstellung ab, bleibt dennoch das Bild einer vielseitigen Frau bestehen: Sie ist zugleich eine böse, alte Hexe, eine erfolgreiche Unternehmerin, eine Herrscherin über ihren eigens eingerichteten Mikrokosmos, zudem Mutter eines Kindes, dem gegenüber sie sich erstaunlich besorgt, liebevoll und verletzlich zeigt. Letzteres kontrastiert ihre anderen Eigenschaften und macht sie zu einer runden, vielschichtigen Figur. Sie ist eine mehr als starke Frau im Film. Ist sie also auf perfide Weise feministisch? Im Sinne eines kommerziellen Feminismus, eines „trickle-down“- oder „have-it-all“-Feminismus, in dem einzelne Frauen durch harte Arbeit und persönliches Engagement Erfolge in der (männlich dominierten) Arbeitswelt erzielen, könnte man sie als Feministin interpretieren. Sie führt keine klassisch weiblich konnotierte Arbeit aus, sondern verkörpert den Typus der strebsamen Karrierefrau. Sie zeigt sich emanzipiert von den geschlechterspezifischen Rollenerwartungen, da sie eine vollständig eigenständige Unternehmerin ist, noch dazu alleinerziehende Mutter. Allein diese Aspekte sind bewundernswert, doch die Emanzipation im weiteren Kontext ist unsolidarisch: Es geschieht eine Division von Frauen mit unterschiedlichen Voraussetzungen, da im kommerziellen Feminismus der erlangte Wohlstand nicht automatisch auf andere Frauen abfärbt, sondern bloß die Klassenunterschiede verstärkt – was im Kontrast zu ihren Mitarbeiterinnen, die sich sogar einen Schlafraum teilen müssen, nur zu deutlich wird. Dies wird bei Yubaba noch dadurch verschärft, dass sie nicht nur andere Frauen nicht an ihrem Erfolg und Wohlstand teilhaben lässt, sondern diesen sogar auf der Ausbeutung anderer Frauen (und Männer) aufgebaut hat. Sie ist ein Anti-Beispiel für den neoliberalistischen Feminismus, der offensichtlich Miyazakis Wertesystem widerspricht, und für den Kapitalismus im Allgemeinen.
Lin
Sie ist eine geübte, routinierte und angesehene Arbeiterin im Badehaus. Sie zeigt sich schnippisch, selbstbewusst und dennoch mütterlich-fürsorglich für Chihiro. Der Zuschauer erlebt sie in der Hauptsache als Repräsentantin ihrer Gruppe, der weiblichen Arbeiterinnen-Community, er wird aber nicht mit ihren persönlichen Hintergründen vertraut gemacht. Auch erfährt Lin wenig charakterliche Wandlung im Filmverlauf und bleibt deshalb ein eher flacher Charakter. Trotzdem ist ihre Figur mehr als vielsagend und mit verschiedensten gesellschaftlichen Symbolen und Motiven aufgeladen. Eines der wichtigsten darunter ist die Art der Arbeit, die sie und die anderen Arbeiterinnen verrichten – sie putzen die Bäder, sie umsorgen, betreuen, verwöhnen und waschen die göttlichen Gäste im Yuya. Obwohl die Identität aller MitarbeiterInnen diesen samt ihren Namen bei der Einstellung im Badehaus von Yubaba genommen wird, leisten sie immer noch Identitätsarbeit, affektive und emotionale Arbeit: Insbesondere die Frauen haben ihr ganzes Wesen auf das Gefallen der Badegäste auszurichten. Sie haben freundlich, zurückhaltend, charmant zu sein und einige haben zu kokettieren. Noch offensichtlicher ist aber die Care-Arbeit, die sie zu verrichten haben: Das Waschen der Gäste kann im übertragenen Sinn als Alten- oder Krankenpflege gelesen werden, wenn nicht gar als prekäre Form der Sexarbeit. In letzterer träte Yubaba als wohlhabende Kupplerin auf, die die Frauen in ihrer Ausbeutungssituation gefangen hält. Immer wieder tauchen im Film rot leuchtende Laternen bei Nacht auf, die eine Interpretation des Yuya als Bordell stützen könnten. Die ausgebeuteten Arbeiterinnen haben keine wirkliche Chance und nur illusorische Hoffnung auf Verbesserung ihrer Lebenssituation, auch wenn sie sich keine Verbitterung anmerken lassen – sie sind durch finanzielle Not, Zauber und Identitätsverlust an Yubaba gebunden. Als Ausgleich kümmern sie sich innerhalb ihrer Community umeinander, weshalb Lin sich auch fürsorglich Chihiros annimmt. In einem Gespräch mit ihr äußert Lin, mit melancholischem Blick auf eine Stadt in der Ferne, die durch ein Meer scheinbar unüberwindlich von ihr abgeschnitten ist: „Irgendwann mach ich hier ‘nen Abgang. Und dann schaff‘ ich es bis in diese Stadt.“ Reale Möglichkeiten oder Pläne zur Verwirklichung dieses Traums vom sozialen Aufstieg sind nicht weiter Thema.
Warum entwirft Miyazaki Lin und ihre Kolleginnen auf diese Weise? Es ist keineswegs Befreiung oder Emanzipation dargestellt. Radikale Emanzipationsbestrebungen prägen den Zweite-Welle-Feminismus des letzten Jahrhunderts. Doch dieser war im Kern verknüpft mit dem Neoliberalismus und ging häufig mit wirtschaftlicher Emanzipation, Lifestyle- und Konsumentscheidungen einher und hat Fragen nach der Arbeit der breiten weiblichen Masse oft außen vor gelassen. Aber das weibliche Arbeitsproblem ist deshalb nicht gelöst, sondern besteht weiter – immer noch verrichten Frauen in kapitalistischen westlichen Staaten signifikant mehr (unbezahlte) Hausarbeit, Care-Arbeit und affektive Arbeit als Männer. In diesem Sinne kann Chihiros Reise ins Zauberland als Kritik am Postfeminismus betrachtet werden, der die Anliegen von Frauen in ihren Tätigkeiten aufgrund der Möglichkeit zur (bezahlten) Fürsorgeauslagerung oder aufgrund des sozialen Konstruktivismus von Geschlecht als gelöst oder obsolet ansieht – beides ist faktisch nicht der Fall, da bestimmte Arbeiten weiterhin als gegenderte Phänomene auftreten.
Chihiro
Die weibliche Hauptfigur des Films ist der Charakter, der wohl die stärksten Wandlungen im Handlungsverlauf durchmacht. Zu Beginn ist Chihiro schüchtern, unsicher, mürrisch und leicht reizbar – wie ein zehnjähriges Mädchen, das gerade unfreiwillig seinen Wohnort wechseln muss, eben zu sein hat. Ihre Eltern sind im Gegenteil ausgesprochen selbstsicher und bewegen sich selbstverständlich in der Welt, auch in der Zauberwelt, die nicht die ihre ist. Sie zeigen sich ignorant und unaufmerksam gegenüber Chihiros Sorgen. Als die Gier der Eltern ihnen zum Verhängnis wird, wird schlagartig Chihiro verantwortlich. Sie kämpft darum, im Badehaus Arbeit zu erhalten, um überleben zu können, und kämpft des Weiteren um einen sicheren Stand im Betrieb. Ihre erste Arbeit versucht sie bei Kamaji im Heizungskeller zu verrichten, wird jedoch nach offizieller Anstellung schnell an einen „passenderen“ Ort verwiesen: Sie verrichtet nun zusammen mit Lin Hausarbeit und Care-Arbeit. Vom Ohngesicht, das sich besonders auf Chihiro fixiert hat und sie mit (falschem) Gold zu bestechen versucht, wird vehement affektive Arbeit eingefordert. Chihiro bildet den Gegenpol zur dargestellten Habgier ihrer Eltern und der Zauberwesen, indem sie das Gold des Ohngesichts ablehnt und sich stattdessen auf ihre persönlichen Bindungen und Ziele konzentriert. Als die Filmhandlung sich zuspitzt, übernimmt sie gleich für mehrere Figuren und Problemlagen zugleich Verantwortung: für den verletzten Haku, das Ohngesicht, für Yubabas verwandeltes Baby sowie für die Rettung ihrer eigenen Eltern.
Miyazaki hat Chihiro nicht nur als Sittenträgerin entworfen, sondern auch als Destabilisatorin des dargestellten Systems. Sie unterminiert die Obrigkeit, befreit sich, ihre Eltern sowie Haku aus ihrer Knechtschaft und zieht zuletzt auch die anderen MitarbeiterInnen des Badehauses auf ihre Seite. Selbst Yubabas Kind kritisiert seine Mutter, nachdem es mit Chihiro Freundschaft geschlossen hat. Doch diese Entwicklung verharrt in einem kleinen, individuellen Rahmen: Chihiro stellt die Verhältnisse auf den Kopf, doch sie verschwindet daraufhin aus der Zauberwelt, in der die Machtstruktur sicher bestehen bleibt. Aus ihrem Erscheinen ist keine Revolution erwachsen. Chihiro fungiert eher als eine Figur, welche die Missstände eines ganzen Systems deutlich macht, diese jedoch nicht gänzlich auflösen kann – wie auch in der „realen Welt“ strukturelle Änderungen vonnöten sind und einige wenige Vorbilder à la trickle-down-Feminismus allein nicht ausreichen, um Veränderung zu bewirken.
Quellen:
Kono Shintaro (2017): „Did Spirited Away Dream of Third-Wave Feminism? From Identity
Labor to Care Labor”. In: Hitotsubashi Journal of Arts and Sciences 2017, 2, S. 9-36.
Suzuki Ayumi (2009): „A Nightmare of Capitalist Japan: Spirited Away”. In: Jump Cut. A Review of Contemporary Media 51:
Foto: Christiano Sinisterra, nachbearbeitet